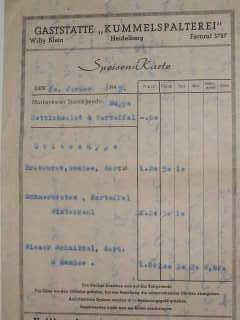|
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
HD - Pleikartsförsterhof |
Robert Fréard
Geboren 1926
Wohnung: Raon l'Etape
Zwangsarbeit bei Grau-Bremse,
Pfaffengrund
Lager: Pleikartsförsterhof
|

Robert Fréard in seinem Haus in Raon l'Etape
|
|
Ankunft in
Heidelberg
Das Besondere war: Wir wurden aufgeteilt in der alten Universität
[= Marstall]: Wir kamen zu Grau-Bremse. Wir waren zwischen sieben und
neun bei Grau, also ein kleines Kommando, wenn ihr so wollt.
Lager in einem Wohnhaus im
Pleikartförsterhof
Ich habe in der Grau Bremsenfabrik im Pfaffengrund gearbeitet und ich
wohnte auf dem Pleikartsförsterhof, einem kleinen Weiler da. Wir
waren in einem Privathaus untergebracht, welches einer Frau Crone
gehörte, ihr Sohn war Arzt, glaube ich. Ich habe diese Haus
später wiedergefunden, aber es war sehr verändert.
Aber wir waren sehr wenig bewacht. Wir waren in diesem Privathaus
allein, aber wir waren ein wenig abhängig von einem Kommando von
Kriegsgefangenen, die sich in einer Kneipe auf dem
Pleikartsförsterhof befanden. Da war so ein Gasthaus am dem
Dorfplatz da im Weiler. Und der Besitzer des Gasthauses war
gleichzeitig ein wenig verantwortlich für das Kommando von
Kriegsgefangenen, welche in einer Baracke lebten, die im Hof des
Gasthauses stand.

Unterkunft der Zwangsarbeiter
von Grau-Bremse im ersten Stock dieses Häuschens. Der Sohn
von Frau Crone war Kunstmaler, sein Vater Bibliotheksrat an der
Universitätsbibliothek
|
In dem kleinen Haus gab es einen kleinen Ofen mit einer Feuerstelle und
einen kleinen Gasherd in einer Küche im Erdgeschoss, direkt neben
dem Zimmer der guten Dame. Und dort feuerten wir ein wenig an. Damit
wir heizen konnten, das sage ich euch, da haben wir alle Pflöcke
rausgerissen von den Zäunen entlang der Eisenbahnlinie, die wir
fanden. Und dann haben wir die ganze Umzäunung vom Sportplatz in
Kirchheim abmontiert. Wir haben für die Heizung absolut
nichts bekommen...
F: Ihre Unterkunft war also geheizt?
Nein, der Ofen heizte in der Küche, nein, wir hatten [im Quartier]
überhaupt keine Heizung. Ich legte meinen Mantel auf mein Bett und
dann die Kartoffeln in meinen Hut.
Das Haus war nur zum Teil beschlagnahmt, und
diese gute Dame, die schon sehr alt war, lebte in zwei Zimmern im
Erdgeschoss. Und wir hatten im Erdgeschoss die Küche, die
nach hinten hinausging und dann waren wir im Obergeschoss in auch
nur zwei Zimmern untergebracht.
Wir waren getrennt, wir waren unter uns. Beim Eingang gab es einige
Stufen, links waren die beiden Zimmer der braven Frau, rechts war
unsere Küche, und dann stiegen wir die Treppe hinauf.
|
|
Arbeit in der Fabrik
Von diesen Gefangenen [aus dem Gasthaus-Lager] arbeiteten viele mit uns
in der Fabrik. Sie haben uns den Weg zur Arbeit gezeigt. Man ging zu
Fuß, man überquerte die Eisenbahnlinie, dann kam man in den
Pfaffengrund. Da gab es ein Wohnviertel, mit einem Wasserbassin sicher
für mögliche Brände. Und dann von da überquerte man
die Straße nach Heidelberg, um in die Fabrik zu kommen, die
gegenüber lag.
Wir fabrizierten Einzelteile für die Eisenbahn, Vorrichtungen
für dampfgesteuerte Waggonbremsen, und dann auch andere
Bremsvorrichtungen für Luftdruck.
denn wir arbeiteten in Schicht: Eine Woche am Tag und eine Woche in der
Nacht, jeden Tag jeweils zwölf Stunden mit einer
kleinen Unterbrechung für die Mahlzeit
Unsere kleine Gruppe war über die ganze Fabrik verteilt. Es gab da
viele französische Kriegsgefangene, Leute aus Paris, Leute aus
Nordfrankreich, die ein wenig die Kontrolle über die Fabrik
mitbestimmten: Das waren Spezialisten, sie schärften die
Werkzeuge, weil sie die Spezialisten waren, und es gab praktisch kaum
mehr Deutsche
Ich war verantwortlich für diese kleine Gruppe auf dem
Pleikartsförsterhof, denn ich habe ein wenig deutsch gesprochen,
was ich in der Schule gelernt hatte, deshalb hat man mich zum Sprecher
der Gruppe ernannt. Ich war damals 19 Jahre alt. |
Was mich überrascht hat: da kamen mit uns zum Arbeiten
KZ-Häftlinge, ich weiß nicht, wer sie waren. Aber ich habe sie da in ihren
gestreiften Anzügen gesehen. Sie haben nicht mit uns zusammen gegessen.
Sie wurden dazu in eine besondere Ecke gebracht während der Mahlzeit
mit ihren Wachleuten. Wir wussten nichts von ihnen, ob es Franzosen
waren wie wir. Das war auf dem Fabrikgelände. Ich weiß nicht, von welchem
Lager sie kamen. Einer von ihnen hat mich sogar [auf Französisch] nach
einer Karte und einem Messtischblatt gefragt. Es war ihm gelungen,
mich zu fragen, aber ich habe es überhaupt nicht verstanden [worum es ihm
ging].
F: War das eine kleine Gruppe?
Das war eine kleine Gruppe politischer Gefangener, ich habe nur mit einem
einzigen gesprochen...
Es waren auch Russen da mit uns, das waren Frauen.. Es gab da Arbeiter aus
fast überall her..
Aber man hat uns korrekt behandelt. Deshalb habe ich nichts gemacht, was in
Richtung Entschädigungsantrag geht. Es war korrekt, wir wurden nicht
misshandelt.
|
|
Verpflegung
Die Verpflegung war sehr unterschiedlich. Denn wir haben einmal am Tag
eine Mahlzeit bekommen, das war fünfmal in der Woche, .
Man konnte sich fast satt essen, das Essen war nicht extrem wichtig,
wenn ihr so wollt. Ich habe nicht sehr viel Hunger gehabt, nein. Und
die anderen Mahlzeiten haben wir selbst gemacht.
Frage: Sie haben Marken bekommen?
Also hört mal, die Deutschen waren ja im Grund nicht
verrückt, die Leute von der Fabrik. Damit wir gearbeitet haben,
haben sie uns Essen gegeben. Da wir nur fünf Mahlzeiten in der
Woche erhielten, gaben sie uns Geld, damit wir uns etwas kaufen
konnten. Ich bekam also einen Lohn, aber der war natürlich
unbedeutend.
Aber mit dem Geld konnten wir mit der Straßenbahn fahren. Wir
waren ja frei, ich hatte einen „Ausweis“. Ich bin einmal von Gendarmen
angehalten worden, die nach meinem Ausweis gefragt haben, das war alles.

Werkausweis
von Robert Fréard
Der Personalchef hat mir Gruppenmarken gegeben und abends mussten
wir Einkäufe machen. Wenn ich um sechs Uhr abends aus der Fabrik
kam, dann war es schon ganz dunkel. Das war im November, da wurde
abgedunkelt, es gab Luftschutzräume. Und ich kannte da
überhaupt nichts, gar nichts, und konnte die Sprache nur ein
wenig.
Aber da habe ich eine französische Dame gefunden von etwa vierzig
Jahren, die war die Geliebte eines deutschen Offiziers, die aus
Frankreich weggegangen war und mit uns in der Fabrik arbeitete. Eine
Woche lange führte sie mich in die ganzen Geschäfte, um die
Einkäufe zu machen. Sie machte die Einhäufe, ich nahm die
Waren mit und dann teilte ich sie mit den Kameraden am Abend.
Wir konnten auch in Restaurants gehen. Zum Beispiel am
Sonntagnachmittag: wir hatten Weißbrotmarken in unserer Ration.
Diese Marken für Weißbrot haben wir aufgehoben und an den
Sonntagnachmittagen sind wir in die Konditorei gegangen, wir haben ein
Dessert gegessen, wir haben einen Kaffee getrunken, sogar ein Eis
manchmal, wo man einen Radioempfänger hatte.
|
Kleidung
Also mit den Kleidern, das war schlimm: Ich bin weggegangen mit einem
Hemd, einem Pullover, einem alten Mantel und dann mit einem Paar Stiefel
[wegen der angeblichen Erdarbeiten] sowie mit Socken. Die Stiefel waren
schon durchlöchert während des Fußmarsches nach Hemingen, den wir am
Anfang machen mussten. Ich hatte also nasse Füße.
Und dann konnte man sehen, wie die die Socken kaputt gingen. Ich habe die
Enden der Ärmel meines Hemdes abgeschnitten, um daraus Socken für meine
Füße zu machen. Und dann haben uns die Deutschen Holzschuhe geliefert.
Und das, das war schrecklich, denn darin bekam man schmerzende Füße, das
war eine Qual, wirklich die Füße im Feuer.
Nach einigen Tagen haben wir blaue Arbeitsanzüge bekommen. Aber dafür
mussten wir bezahlen, ich glaube, dass sie 20 Mark gekostet haben. Und wir
hatten doch noch kein Geld...
Also die Kriegsgefangenen in der Fabrik haben uns misstrauisch
beäugt. Ich habe mich gefragt, was da los war. Ich bin ihrem
Vertrauensmann in der Toilette der Fabrik begegnet. Und da habe ich
gesagt: „Was habt ihr gegen uns?“ Er hat mir gesagt: „Hört mal, ihr
seid Kollaborateure! Ihr gehorcht den Deutschen!“
Nun hatte ich hatte jedoch im meinem Geldbeutel Flugblätter, die uns die
Amerikaner mit Granaten herübergeschossen hatten in Granaten. Sie waren
an den Ecken angebrannt. Diese Flugblätter habe ich den Kriegsgefangenen
gezeigt und ihm erklärt: „Sie haben uns deportiert [in der letzten
Minute]..."
So hatte ich den Beweis geliefert. Am nächsten Morgen gab es die Marken,
er hat mir Geld gegeben und ich konnte damit die Arbeitsanzüge kaufen.
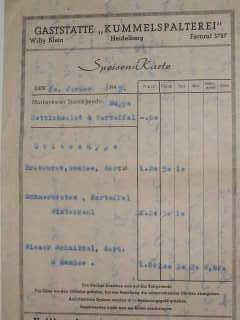
Speisekarte der "Kümmelspalterei" vom 20. Januar 45, wo
Herr Fréard offensichtlich eingekehrt war. Er hat sie
aufgehoben, weil ein französisch sprechender Gast auf der
Rückseite notiert hatte, wo man als Kranker Krankengeld bekommen
konnte.
|
|
Was schlimm für mich war
Wir waren Nomaden, von niemand anerkannt, völlig ignoriert von
allen, ohne Kontakt zu unseren Familien, ohne zu wissen was bei uns zu
Hause los war. Das war schon ein wenig hart. Wir haben überhaupt
nichts gewusst.
Allerdings sind einige unserer Kameraden geflohen, ich glaube, es waren
vier.
Wenn man etwas von Raon erfahren hat, dann nur ganz indirekt: Als wir
von Raon wegkamen, hatten dort französische Milizionäre
gewütet [unter der Leitung der Gestapo]. Sie haben mitgewirkt bei
der Verhaftung des Bürgermeisters [der dann vor dem Rathaus
erschossen wurde].
Siehe die Gedenktafel in Raon auf der Eppelheim-Seite.
Und diese Milizangehörigen haben wir in einer Kneipe in Kirchheim wiedergefunden, das ist
doch verrückt! Wir konnten aber nichts machen, wir haben
überhaupt nichts gemacht gegen sie.
Es hatte ja vor unserer Deportation Auseinandersetzungen mit dem Macquis
gegeben.
|
Kontakt zu Deutschen: Baiertal
Um Essen zu
bekommen, sind wir an den Sonntagen zu den Bauern gegangen, um
Kartoffeln zu bekommen. Wir hatten ein kleines Dorf entdeckt, das
Baiertal heißt, das liegt nahe bei Wiesloch. Wir fuhren mit der
Straßenbahn dorthin. Und dort sind wir auf eine Weise
empfangen worden, also das war außergewöhnlich: Wir sind
sogar vom Bürgermeister des Dorfes begrüßt worden, das
ist doch verrückt, oder? Der hat uns einen Milchkaffee angeboten
und Weißbrot mit einer kleinen Wurst.
Das war fast jeden Sonntag, wenn wir hingehen konnten. Und wir bekamen
Kartoffeln auf den Bauernhöfen. Die französischen
Kriegsgefangenen dort haben uns das gegeben.
Über den Geisteszustand der deutschen Bevölkerung kann ich
mich nicht beklagen. Außer über einige junge Nazis, die sich
aufgeplustert haben, als die Ardennenoffensive begann. Das war im Monat
Dezember 1944 während dieser Ardennenoffensive. Da hat sich die
Bevölkerung von neuem uns gegenüber ein wenig
verächtlich verhalten. Aber das hat nicht lange gedauert.
Wirklich, einmal habe ich dort eine alte Dame getroffen, die mir Fett
gegeben hat, die mir Schweineschmalz gegeben hat und dann Tabak. Sie
haben dort Tabak angebaut. Und ich habe gefragt, was ich ihr dafür
schulde. Und sie hat geantwortet: Gott wird es mir zurückgeben.
Ich habe dort eine Bäckerei entdeckt: Wir bekamen dort doppelt
soviel Brot wie wir Brotmarken hatten.
|
|
Kriegsende, Befreiung
Die alte Dame, Frau Crone, ist gerade in dem Augenblick
gestorben, als die Amerikaner angekommen sind. Und es gab einige Lumpen
unter uns, die dann in ihrer Habe geplündert haben...
Als die Amerikaner gekommen sind, haben sie uns fast schlimmer
behandelt als die Deutschen.Wir waren froh, sie ankommen zu sehen, wir
hatten weiße Fahnen. Sie haben uns aufgeladen mit ihren
Waffen.Wir sind mit den Amerikanern zusammen nach Kirchheim
hineingefahren.
Nach der Ankunft der Amerikaner verbrachten wir zwei Wochen in
einer deutschen Kaserne. Da hatten wir mehr Hunger als die ganze Zeit
vorher. Diese Kaserne war in Heidelberg oder in der Umgebung von
Heidelberg und dann wurden wir repatriiert über Mannheim. |

Robert
Fréard, Repatriierungsausweis
|
André Bayard
Geboren 1926
Wohnhaft in Deneuvre bei Baccarat
|
|
|
F: Wie war die Verschleppung aus Frankreich?
Da war die Front ganz nahe an Baccarat. Die Deutschen dirigierten uns
nach Pexonne, wir waren mit der ganzen Familie nach Pexonne evacuiert.
Dort haben mich dann meine Schwester und meine Mutter in der Kolonne
davonziehen sehen. Die Deutschen befahlen, und wir mussten gehorchen.
Man hatte keine andere Wahl, manche dachten zu fliehen, ich nicht. Wir
wussten nicht, wohin es ging..
Die Fabrik, wo ich in Heidelberg arbeitete,
hieß „Bremsenfabrik“. Ich arbeitete an Material mit Dreharbeiten,
um es Euch genau zu sagen: das war für LKWs, glaube ich. Ich
war eigentlich kein Dreher.
Die Arbeit war nicht im eigentlichen Sinn hart, aber es waren
gleichwohl zwölf Stunden am Tag, zwölf Stunden am Tag und
zwölf Stunden in der Nacht, das wechselte ab.
Die Behandlung durch die Deutschen, darüber kann ich nichts
Schlechtes sagen, das ist alles. Und sonst habe ich meine Arbeit
gemacht. Sie haben uns verpflegt, damit wir arbeiteten...
Wir hatten genug zu essen, man schlug sich so durch. Wir bekamen eine
Mahlzeit in der Kantine, einmal am Tag, außerdem einen kleinen
Imbiss, das sie uns gaben.
Die Kleider -, wir hatten blaue Arbeitsanzüge, die sie uns
für die Arbeit gegeben hatten. Und die Schuhe hat man uns
repariert. Man verwies uns an einen Schuhmacher und dann hat er die
Schuhe repariert. |
F: Haben Sie
Heidelberg besucht?
Wir waren frei, aber wir hatten nicht viel Zeit, am Sonntag vielleicht,
wissen Sie. Wir hatten keine Freizeit, die ging vielmehr für
unsere Nahrungsversorgung drauf, für unsere Behausung. Man musste
etwas organisieren für die Heizung. Da war nur etwas Kohle, die
wir bekommen haben.
Wir haben etwas zu essen gesucht bei den Bauern. Es gab ein Dorf etwas
weiter entfernt, wo wir zu Fuß hingingen, und da gaben uns die
Bauern Kartoffeln, ein Stück Speck, manchmal bekam man sogar einen
Milchkaffee bei ihnen am Tisch. Sie ließen uns nichts dafür
bezahlen.
Oh ja es war schon ein Unterschied, wir haben mehr gelitten als in
Frankreich..., ich war allein, ohne die Familie, alle waren zerstreut.
Damals war ich 18 Jahre alt, ich hatte schon in einer Fabrik
gearbeitet.
Die Umstände waren nicht einfach, in Frankreich auch
nicht, aber in Deutschland habe ich mehr Unglück gehabt.

Lager Pleikartsförsterhof
|
|